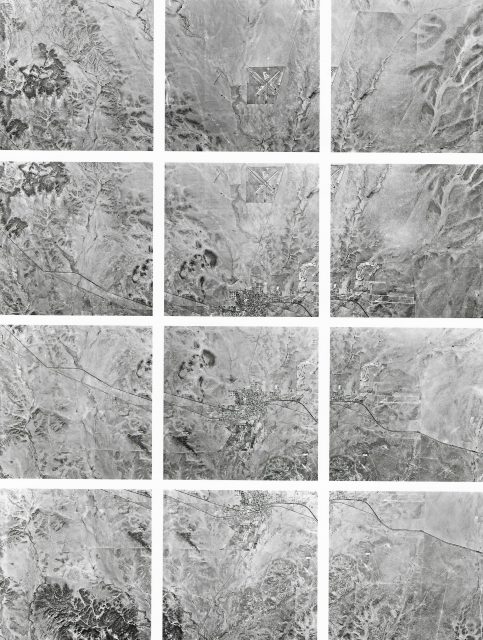Jeff Walls „The Listener“ von 2015 deutet vieles nur an. Vielleicht spielt die Szene in einem ausgetrockneten Flussbett, vielleicht in einer Art Grube. Im Hintergrund erkennt man ein Stück Mauer, das blau angestrichen ist. Zur rechten Seite steigt ein Böschung an. Der Bildraum ist abgeschlossen und öffnet sich allenfalls nach vorne, zum Betrachter der Szene. Die Lage ist ausweglos.
Es muss heiß sein. Die Sonne steht zum Zeitpunkt des Geschehens hoch und die Personen auf dem Bild werfen nur einen kleinen Schatten. Die Erde ist ausgetrocknet.
 Sechs Männer stehen um einen Mann, der mit nacktem Oberkörper am Boden kauert. Er ist die einzige Person auf dem Bild, die ganz dargestellt ist. Und nur von ihr sehen wir auch das Gesicht, da die Figur frontal zur Bildebene abgebildet ist. Kopf und Gesicht des Mannes, der rechts von dem am Boden kauernden Mann steht, sind nur zur Hälfte und nur von hinten zu sehen, da er mit dem Rücken zum Betrachter des Bildes steht. An der linken Bildseite ein weiterer Mann, von dessen Gesicht ein Teil erkennbar ist, da er, hart angeschnitten, direkt aus dem Bild heraus den Betrachter des Geschehens anblickt. Von den übrigen Personen, die rechts und links stehen, sind keine Gesichter zu erkennen. Sie sind durch die Wahl des Bildausschnitts schlicht abgeschnitten.
Sechs Männer stehen um einen Mann, der mit nacktem Oberkörper am Boden kauert. Er ist die einzige Person auf dem Bild, die ganz dargestellt ist. Und nur von ihr sehen wir auch das Gesicht, da die Figur frontal zur Bildebene abgebildet ist. Kopf und Gesicht des Mannes, der rechts von dem am Boden kauernden Mann steht, sind nur zur Hälfte und nur von hinten zu sehen, da er mit dem Rücken zum Betrachter des Bildes steht. An der linken Bildseite ein weiterer Mann, von dessen Gesicht ein Teil erkennbar ist, da er, hart angeschnitten, direkt aus dem Bild heraus den Betrachter des Geschehens anblickt. Von den übrigen Personen, die rechts und links stehen, sind keine Gesichter zu erkennen. Sie sind durch die Wahl des Bildausschnitts schlicht abgeschnitten.
Das Zentrum des Bildes bilden der am Boden kauernde Mann und der Mann, der rechts von ihm steht und sich leicht zu ihm hinunterneigt. Der linke Arm des stehenden Mannes hängt herab, während der linke Arm des Mannes am Boden wie zum Schutz nach innen gedreht ist. Zu sehen ist also eine Gewaltsituation, die sich offenbar noch in einem frühen Stadium befindet. Die körperliche Gewalt ist zum Zeitpunkt des Geschehens aber offenbar noch begrenzt. Vielleicht gab es bereits erste, verachtende und leichte Schläge. Blut aber ist noch nicht geflossen. Wohin die Eskalation der Gewalt noch führen könnte, ist allenfals angedeutet im Stein, der im rechten Vordergrund hinter dem stehenden Mann auf dem Boden liegt.
Was indes dargestellt ist, ist die verbale Drohung. Deutlich herausgearbeitet ist das linke Ohr des Mannes am Boden. „The Listener“, der Zuhörer: Das ist also zunächst einmal die Figur des Mannes auf dem Boden, der von dem unmittelbar neben ihm stehenden Mann etwas zu hören kriegt.
Wäre dem so, dann wäre das allerdings ein recht zynischer Titel für ein Bild, das die Gewalt darstellt, die ein Einzelner durch eine Gruppe erfährt.
Jeff Wall hat allerdings noch eine andere Zuweisung ins Spiel gebracht. In einem Interview äußert er: „Ich entschied, dass ich gegen den Strich gehen und ihn etwas sagen lassen würde … und außerdem wollte ich, dass jemand zuhört.“ Der Zuhörer ist nach Wall also der Betrachter, den die Figur ganz rechts aus dem Bild heraus anblickt. Der Betrachter kann dabei der Betrachter des fertigen Bildes sein, oder aber der Betrachter, der solche Szenen überhaupt erst Bild werden lässt: der Fotograf. In jedem Fall aber ergeht mit dem Titel die Aufforderung an den Betrachter respektive die Fotografie, die bloße Betrachtung im Hinblick auf eine Anteilnahme am Leiden anderer zu überschreiten.
Jeff Walls Bilder mögen wie Schnappschüsse aussehen. Tatsächllich sind sie jedoch das Ergebnis von aufwändigen Aufnahmeprozessen. Szenen, Bewegungsabläufe, Körperhaltungen und Mimik sind bis ins Detail geplant. Für „The Listener“ aus dem Jahr 2015 studierte Wall über Monate Bilder von Gewaltsituationen. Neben Kunstbildern betrachtete er dabei insbesondere auch Medienbilder, die solche Gewaltsituationen zeigen und mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Wall selbst bezeichnet diese Herangehensweise als „near documentary“. Was wir in „The Listener“ zu sehen bekommen, ist also in gewisser Weise das Abstraktum eines Bildes, das eine Gewaltszene zeigt, ein Derivat der vielen bildgewordenen Szenen, die wir tagtäglich zu sehen bekommen.
Jean Baudrillard hat unsere Gegenwart bekanntlich als ein Zeitalter der Simulation beschrieben, in dem sich die Welt in einem derart fortgeschrittenen Zustand der Verbildlichung befindet, dass es zunehmend unmöglich wird, den Unterschied zwischen Bild und Wirklichkeit überhaupt noch zu bestimmen. Bilder und Zeichen beruhen laut Baudrillard gerade nicht mehr auf der Nachahmung eines Originals, sondern unterlaufen das Prinzip der mimetischen Nachahmung. Das Bild bildet nichts mehr ab, es verweist als „sein eigenes Simulakrum“ auf keine Realität mehr. Was die Simulation als „Gegenkraft der Repräsentation“ erzeugt, sind Bilder ohne Vorbilder.
Walls „The Listener“ kann vor diesem theoretischen Hintergrund durchaus als kritische Auseinandersetzung mit einem Begriff des Bildes als Simulakrum verstanden werden. Indem Wall versucht, dem Opfen eine Stimme zu geben, indem er dem Bild mit dem Titel einen Zuhörer zuweist, versucht er dem Bild einen Referenten zu geben und es wieder an die Wirklichkeit zu koppeln. Diese Rereferenzierung ist allerdings fragil und erreichbar nur über die im Titel des Bildes gesetzte Ansprache eines Sinnes, der mit dem Bildhaften und der Fotografie nichts zu tun hat. Der Referent, auf den das Bild neuerlich verweisen soll, kann, wie der Titel zum Ausdruck bringt, nur über das Zuhören vermittelt werden. Um das Bild vom Leiden an den Referenten des Leidens wieder anzukoppeln, bedarf das Auge des Ohres.
Jeff Wall. Appearance
Kunsthalle Mannheim
02.06.2018 – 09.09.2018
Bildquelle
Jeff Wall: Appearance. Kunsthalle Mannheim